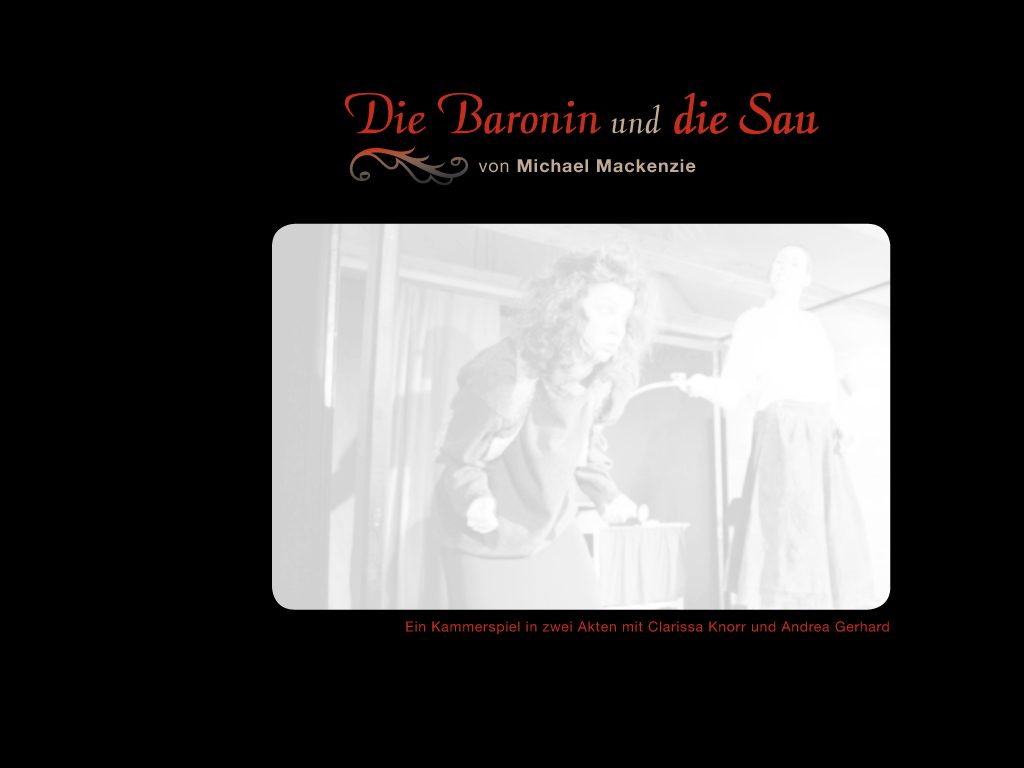Stückinhalt
Stückinformation
Hintergrundinformation
Autor
Im Jahre 1762 erschien der Erziehungsroman „Émile ou de l' Éducation" des
französischen Philosophen und Literaten Jean-Jacques Rousseau. Die Thesen
dieses großangelegten pädagogisch-philosophischen Traktates revolutionierten
die damalige Pädagogik, denn seine Idee, die Eigenart der kindlichen Psyche
systematisch zu erforschen hatte große Nachwirkungen auf alle bedeutenden
Erzieher des 19. Jahrhunderts von Pestalozzi über Herbart, Pinel bis zu
Fröbel, auch wenn diese viele seiner Ideen in Frage stellten.
Rousseaus These, dass der Mensch von Natur aus gut sei und nur durch
Zivilisation und Gesellschaft korrumpiert werde, führte vor allem im 19.
Jahrhundert zur Romantisierung von Findelkinder-Schicksalen, die in völliger
Isolation von Menschen aufgewachsen waren. Der spektakuläre Fall von Kaspar
Hauser belegt dies eindrücklich: Er wurde nach seiner Auffindung in Nürnberg
zum Mittelpunkt gefühlvoller Salons und geriet dadurch seelisch aus dem
Gleichgewicht, was den Schöpfer des bayrischen Strafgesetzbuches von 1813,
Paul Johann Anselm von Feuerbach, zu einer denkwürdigen Schrift veranlasste:
„Kaspar Hauser. Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen".
Kaspar Hauser wurde 1833 in Ansbach Opfer eines nie aufgeklärten
Mordanschlags.
Im Stück die „Baronin und die Sau" von Michael Mackenzie fühlt sich der
Zuschauer an diesen Fall erinnert, doch verfolgt der Autor bei seiner
interessanten Beziehungsgeschichte zwischen einer höhergestellten Person und
einem bemitleidenswerten weiblichen Findelkind einen anderen Aspekt. Was auf
den ersten Blick wie ein Stück über die erzwungene Wandlung eines primitiven
zu einem dienenden Menschen anmutet, das entpuppt sich auf den zweiten Blick
als ein Stück über die Verwandlung einer unterkühlten Höhergestellten zu
einer anders denkenden und einfühlsamen Frau.